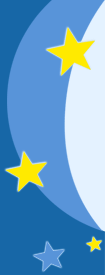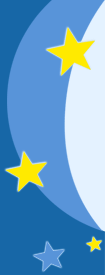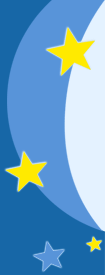 |
|

"Einschlafen, durchgeschlafen, einfach schlafen!" - Tipps und
Wissenswertes für geplagte Eltern und deren Ratgeber
Inhalt:
|
|
 |
Einleitung
Schlaf ist eine der essentiellen und existentiellen Grundzustände
des Lebens. Schlaf ist die Nacht des wachen Tages, ein periodisch
wiederkehrender Zustand von Ruhe, Erholung und Rekreation aller
Organsysteme und Funktionen.
Der Übergang in den Zustand des Schlafes kann jenseits des Kleinstkindalters
willkürlich gesteuert werden, tritt aber auch un-willkürlich ein.
Schlaf ist nicht gleich Schlaf; es werden verschiedene Phasen
und Qualitäten des Schlafes unterschieden, welche mittels Ableitungen
(EEG) gemessen und dargestellt werden können.
Eine Besonderheit des Schlafens bei sehr kleinen Kindern ist
die Rolle und Funktion der Eltern.
Es gibt kein Schlafphänomen im Säuglings- und Kleinkindalter
welches nicht auch die neben/mit oder bei schlafenden Eltern in
Mitleidenschaft zieht, d. h., jede länger als eine wenige Tage
dauernde Schlafstörung eines Kleinstkindes besteht, weckt, befasst
und stört diese zwangsläufig auch seine Eltern.
Das Entstehen von sekundären Interaktionsstörungen und reaktiven
Verhaltensbeeinträchtigungen im Beziehungsverhalten des nachfolgenden
Tages sind häufig.
|
|
 |
Arten des Schlafes und seine Störungen
Man unterscheidet: REM-Schlaf (Rapid Eye Movement)= sogenannt
paradoxer, aktiver Schlaf, in welchem wir träumen und schwer erweckbar
sind. Die längere Zeit schlafen wir im orthograden, nicht-Rem,
in welchem sich die Muskeln entspannen und die Atmung langsam
und ruhig wird. Ab dem 6.-7. intrauterinen Monat besteht bereits
ein REM / non-REM Muster, welches 80% REM und 20% non-REM Muster
zeigt. Im Erwachsenenalter verlagert sich die Situation in ca
25% REM und 75% non-REM. Das "erwachsene" Muster ist bereits im
3.-4. Monat nach der Geburt entwickelt. Pro Nacht werden 4-5 Zyklen
durchgegangen.
Im Säuglings- und Kleinstkindalter ( 0-3 Jahre) unterscheiden
wir Einschlaf- und Durchschlafstörungen.
Bis zum Ende des 2. Lebensmonats ist die elterliche Toleranz
bezüglich Frequenz, Rhythmus und Dauer groß. Mit Anfang des 3.
Lebensmonats beginnt die Erwartung, dass ein regelmäßiger Schlaf
/ Wach - Tag / Nacht Wechselrhythmus entstehen sollte und damit
auch der Druck auf das Baby dieser Erwartung zu genügen. Bei der
Durchschlafstörung hat das Kind die Eigenregulationsmöglichkeit
des Überganges zwischen den verschiedenen Schlafphasen nie gelernt
oder wieder verlernt. Jeder Mensch wacht nämlich pro Nacht 3-5
mal auf, d.h. er durchschläft 3-5 ganze Schlafzyklen (REM- und
non- REM Schlaf) und reguliert die Übergänge zwischen den Zyklen
automatisch und ohne bewusst aufzuwachen durch kleine Bewegungen
und Wechsel im Atmungsmuster.
|
|
 |
Was tun wenn das Kind nicht Schlafengehen will?
Diese Frage entsteht nur dann, wenn nicht das Kind selbst sondern
die Eltern eine fixe Uhrzeit oder den Zeitpunkt des Schlafengehens
bestimmen und es beim gesunden Kind nach der Individuation (ab
778.LM) zu einem oft nicht als solchen deklarierten aber doch
klaren Machtkampf kommt, der in der Regel vom Kind gewonnen wird.
Oder das Kind will nicht einschlafen, weil die Einschlafszene
eine un-lustvolle Situation, z.B. der Trennung vom vergnügten
Rest der Familie bedeuten würde. Oder weil es fürchtet, beispielsweise
im Falle einer ehelichen Krise, dass nach seinem Schlafengehen
ein Streit zwischen den Eltern ausbricht. Ein psychisch gesundes
Kind wehrt sich in solchen Fällen, quängelt oder setzt seinen
ganzen Charme ein und zeigt trotz vorrückender Stunde eindrucksvoll
kreativen Erfindungsgeist und Energie gegen den Schlaf anzukämpfen.
Oder die Schlafenssituation ist einfach unattraktiv: ein schönes
Gitterbett (moderner Kinderkäfig) in einem schön eingerichteten
Kinderzimmer voll mit leblosen Stofftieren: schön aber einsam.
Jedenfalls keine kuschelige, tröstliche, lustbetonte Szene.
Diese Form der Einschlafstörungen kann mit einer einfachen Intervention
geheilt werden: Das Kind wird nicht ins Bett gebracht oder geschickt,
es darf sich im Wohnraum der Restfamilie hinlegen und wird aufgefordert,
sich auszuruhen, aber ja nicht einzuschlafen! Hier kann man auf
die gesunde Paradoxielust des Kleinkindes vertrauen; spätestens
nach 5 Minuten schläft das Kleine tief und fest und kann nach
weiteren 10-15 Minuten ohne jedes Aufwachrisiko in der Tiefschlafphase
ins Bett getragen werden oder das Kind darf sich spielend in einem
weichen Spieleck aufhalten, wo es einschlafen kann ohne schlafen
"gehen" zu müssen. Jede geschilderte Schlafstörung sollte also
zu einer differenzierten und ehrlichen Betrachtung und Reflexion
der Einschlafrituale und Schlafensszenen auffordern. In dubio
pro reo (Im Zweifelsfall für den Angeklagten) gilt hier: Bis das
Gegenteil bewiesen ist hat das Kind recht, d.h. sein Wille Nichtschlafen
zu wollen oder zu können hat einen Sinn. Diesen gilt es zu analysieren,
und vielleicht dann neue Schlüsse und Erkenntnisse zu finden.
|
|
 |
Was tun, wenn es vor dem Schlafengehen Angst hat?
Viele Kinder fürchten sich vor dem Schlaf, Ängste von Sterben
und Bedrohungen, dass etwas passieren könnte während sie nicht
aufmerksam aufpassen, sind häufig. Diese treten oft auch bereits
in einem sehr frühen Lebensalter von wenigen Monaten auf, in welchem
emotionale Inhalte nicht verbal vermittelt werden können. Zum
Teil überschneiden sich die bereits geschilderten Hintergründe
des nicht Schlafen gehen Wollens mit denen des nicht Schlafen
gehen Könnens, welche hauptsächlich aus Angst entsteht. Lange
vor dem Erreichen des magischen Alters (ca. 3-6 Jahre) in der
Kindheitsentwicklung hat das Kind bereits mit Ende des 1. Lebensjahres
ein klares "Ich"-Empfinden, ein "Selbst-Gefühl entwickelt, welches
sich lang vor der Möglichkeit des verbalen Ausdrucks im symbolischen
Spiel des 1-3 jährigen repräsentiert.
Die erste und ursprünglichste Angst ist die Trennungsangst. Es
ist eine existenzielle und sinnvolle Angst. Die Angst die geliebte
Mutter oder jede andere primäre Hauptbezugsperson zu verlieren.
Moderne Möglichkeiten die Bindungsfähigkeit zu objektivieren
sind Videoanalysen von Eltern-Kind Verhalten in standardisierten
Szenen (z. B. Spiel oder Füttern oder Zubettlegen) wobei affektive
und inhaltliche Faktoren wie z. B. Blickkontakt, Vokalisation,
Harmonie und Synchronizität der Körpergestik etc. quantifiziert
werden.
Weiters stehen standardisierte Interviews wie beispielsweise:
"the child working modell interview" von' Ch. Zeanah zur Verfügung
welcher mittels der Erhebung von "intemal representation", d.h.
innerer Beziehungsvorstellungen der Eltern-Kind Beziehung deren
Qualität einschätzt.
|
|
 |
Welche Besonderheiten betreffen Eltern behinderter Kinder?
Bei behinderten Kindern müssen besonders plötzlich auftretende
Schlafstörungen manchmal im Zusammenhang mit der Grunderkrankung
gesehen werden (z. B. Auftreten einer Schlafepilepsie, eines Gastroösophagealen
Reflux etc.).
Insofern sind sie immer mit dem behandelnden Arzt zu besprechen.
Eine spezifische Besonderheit ist vielleicht die Frage nach einem
selbstverursachten Anteil an der erlebten Störung von Eltern behinderter
Kinder. Obschon weder berechtigt noch bewusst werden viele Eltern
behinderter Kinder von Schuldgefühlen gepeinigt. Die subjektive
Störung darf nicht ein-gestanden werden, weil ja das Kind durch
seine Behinderung allein in vieler Hinsicht benachteiligt ist.
Solche Schuldgefühle und Ambivalenzkonflikte sind oft nicht im
realen, logisch begründbaren Bereich zu finden; vielmehr sind
es diffuse, oftmals unausgesprochene, oft selbst nicht reflektierte
Affekte, welche besonders nachts "zu Tage treten".
So kann es dann geschehen, dass der Schlafstörung des behinderten
Kindes nicht mit jener Klarheit und Konsequenz entgegengetreten
werden kann, wie beim Gesunden oder geduldet wird, dass sich subjektiv
unerfreuliche Gewohnheiten entwickeln und festigen. In diesen
Fällen kann eine Reflexion und ein sich Klarwerden über seine
Gefühlswelt und Einstellung, sowie etwaiger latenter Aggressionen
und missgünstiger Gefühle mit einem psychotherapeutisch geschulten
Helfer sehr hilfreich sein.
Sonst treffen im wesentlichen keine anderen Hinweise und generellen
Ratschläge wie für gesunde Kinder zu.
|
|
 |
Zusammenfassung
Schlafen ist eine Tätigkeit welche am besten in einer entspannten,
angstfreien und angenehmen Umgebung statt findet. Manche Menschen
schlafen am besten beim Rauschen eines Laubbaums auf ihrer Lieblingsliege
im stillen aber lauschigen Garten; andere brauchen viel Lärm und
schlafen am besten im Schaukelstuhl des Vorzimmers mitten im Familienrummel.
Manche brauchen viel Platz, andre kuscheln sich gerne eng zwischen
Couchpolster und Wand. Es gibt kulturelle und individuell unterschiedliche
Schlafgewohnheiten und familiäre Schlafmuster.
"Schlaf Kindlein schlaf, ist noch immer gültig. Es ist jedoch
nur umsetzbar, wenn der Vater nicht nur Schafe hütet, sondern
in Falle von Störungen rasche Hilfe und ein einfühlsames Zuhören
können der meist noch viel mehr verstörten und schlafentzugsgequälten
Mutter entgegenbringen kann.
Quelle: Deutsche Behinderten-Zeitschrift 1/99
|
|
 |

|
|