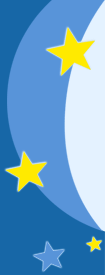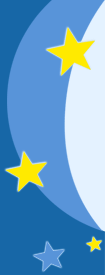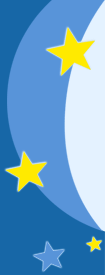 |
|

Grundlagen - Schlaf
|
Schlaf und Schlafstörungen bei behinderten Kindern
Inhalt:
|
|

|
Bedeutung des Schlafes
Schlaf ist einer der unentbehrlichen und existentiellen Grundzustände
menschlichen Lebens. Es handelt sich dabei um einen periodisch
wiederkehrenden Zustand von Ruhe und Erholung aller Organsysteme
und Funktionen, insbesondere der Zentren des Nervensystems. Um
diese Erholung zu gewährleisten, ist eine bestimmte Menge an Schlaf
notwendig, wobei Schlaf nicht gleich Schlaf ist. In Hirnstromableitungen
(EEG = Elektronenzephalogramm) zeigen sich verschiedene Schlafstadien.
|
|
 |
Wie viel Schlaf braucht ein Kind?
Zunächst einmal ist die Frage, ob es Lang- und Kurzschläfer gibt,
mit einem JA zu beantworten. Kinder im Kindergartenalter haben
eine individuell unterschiedliche Schlafdauer von täglich 12 -14
Std., im Grundschulalter variiert sie täglich von 10-12 Std. unter
Berücksichtigung des Mittagsschlafs. Schließlich ist auch an die
Tiefe des Schlafs zu denken. Guter Schlaf wird durch aus-reichende
körperliche Betätigung vor allem in frischer Luft während des
Tages, durch Ausschaltung aller störenden Reize sowie durch gesunde
Lebensführung begünstigt. Regelmäßige wesentliche Unterschreitungen
der Schlafdauer führen zu physischen und psychischen Störungen,
beim Schulanfänger zum Rückgang des Leistungsvermögens in der
Schule.
|
|
 |
Welche Situation ist bei behinderten Kindern zu verzeichnen?
Erfahrungsgemäß haben behinderte Kinder einen höheren Schlafbedarf.
Das betrifft vor allem Kinder mit Folgezuständen nach einer Hirnschädigung
(z. B. nach Meningitis, Enzephalitis, Schädel-Hirn-Trauma), ferner
auch herz-, asthma-, rheuma- und krebskranke Kinder. Hierbei besteht
bei bestimmten Organsystemen (insbes. beim ZNS) ein Erholungsbedarf.
Zu erwähnen sind auch Kinder mit Schädigungen des Haltungs- und
Bewegungsapparates, die rascher ermüden, demzufolge auch ein erhöhtes
Erholungs- und Schlafbedürfnis haben. Von großer Bedeutung ist
der Schlaf für das akut (vor allem fieberhaft) erkrankte Kind.
Im Hinblick auf das Schlafbedürfnis gibt es auch bei behinderten
Kindern individuelle Unterschiede, zuweilen können auch wie bei
gesunden Kindern Schlafstörungen auftreten.
|
|
 |
Arten der Schlafstörungen
Sowohl bei Kindern im Kindergartenalter als auch bei Schülern
im Grundschulalter gehören zeitweise Schlafstörungen zur Lebenserfahrung.
Es kann im wesentlichen - grob gesehen - zwischen Einschlaf- und
Durchschlafstörungen unterschieden werden.
Einschlafstörungen sind bei Kindern wesentlich häufiger als Durchschlafprobleme.
Bei der Einschlafstörung ist das Kind entweder noch nicht müde,
oder das Kind will nicht einschlafen. Schließlich stellt die Einschlafszene
eine unlustvolle Situation dar (Trennung von der Familie). Noch
verständlicher ist die Abneigung vor dem Schlafengehen und vor
dem Schlafen bei einem Kind, wenn es des öfteren zur Strafe ins
Bett gebracht wird. (Androhung "Du gehst jetzt ins Bett!").
Schwieriger gestaltet sich der Umgang mit den Durchschlafstörungen,
schon deshalb, weil die meisten Eltern dabei ebenfalls aus dem
Schlaf gerissen und so in ihrem eigenen Biorhythmus empfindlich
gestört und belastet werden. Von den häufigsten Durchschlafstörungen
sind zu nennen: das nächtliche Aufschrecken und Aufschreien (Pavor
nocturnus), Nacht- und Schlafwandeln (Somnambulismus), Kopf- und
Körper wackelt, das vorzeitige Aufwachen, Durchschlafstörungen
sind abhängig von den Phasen der geringen Schlaftiefe, von Unterbrechungen
des körpereigenen Rhythmus, aber auch vom übertriebenen Verhalten
der Eltern, die bereits bei leisem Murmeln und Brabbeln des Kindes
seinen Schlaf stören.
Im Schlaf setzen sich auch Erregungen bzw. Verunsicherungen,
die das Kind tagsüber erlebt hat, unterschwellig fort. Bedeutung
haben auch Konflikte mit anderen Kindern, mit Kindergärtnerinnen
bzw. mit Lehrern, Leistungsversagen in der Schule, Erlebnisse
von Trennung und Abschied. Es können auch aufregende Erlebnisse
am Abend vor dem Schlafengehen beim: Streit mit Geschwistern,
Auseinandersetzungen zwischen den Eltern, aufregende Fernsehfilme,
aber auch ausgelassenes Toben. Schließlich können auch als "Auslöser"
von Durchschlafstörungen aufkommende Unruhe- und, Schmerzzustände
sowie Atembeschwerden auftreten.
Insgesamt gesehen: Schlafstörungen des Kindes sind immer Interaktionsstörungen,
die auch die Eltern und Geschwister betreffen. Somit ist die gründliche
Kenntnis der inneren und äußeren Entwicklungsbedingungen des betroffenen
Kindes notwendig, um Hilfen anbieten zu können.
|
|
 |
Wie kann man einem Kind mit Einschlafstörungen helfen?
In diesem Falle kann - wie bei allen psychischen Problemen -
kein bewährter Ratschlag es den Eltern abnehmen, die häusliche
Situation auf mögliche Angstauslöser und Störfaktoren hin unter
die Lupe zu nehmen, sich selbst und das betroffene Kind genau
zu beobachten, ggf. das erzieherische Verhalten zu ändern. Für
das kleinere Kind sind Schlafzeremonien bedeutsam, d. h. Abend
für Abend erwartet das Kind eine Abfolge bestimmte Vorgänge, mit
denen der Tag ausklingt. Dazu sind geeignet: Erzählen bzw. Vorlesen
einer kurzen beruhigenden Geschichte, dazu eventuell Betrachtung
eines Bildes, ferner Beten, Singen, Stofftier und Puppe in den
Arm nehmen und zum Schlaf betten. Man sollte das Licht dämpfen
(später ausmachen), die Tür des Kinderzimmers schließen, selbst
ruhig werden sowie durch Körperkontakt und Streicheln eine Kuschelatmosphäre
schaffen. Im Lauf der Zeit können Rituale nacheinander abgebaut
werden.
Vielen Kindern (insbesondere im Grundschulalter)" die an Durchschlafstörungen
leiden, hilft es, wenn sie beim Zubettgehen in einer liebevollen,
entspannten Atmosphäre Gelegenheit haben, über das zu sprechen,
was sie den Tag über geärgert oder beunruhigt hat. Manche entspannen
sich, wenn sie in einem solchen Gespräch getröstet, wenn die positiven
Ereignisse in der Vordergrund gerückt und sie Aussicht auf einen
erfreulichen nächsten Tag haben werden.
Bei hartnäckigen Schlafstörungen sollten jedoch Beruhigungs-
und Schlafmittel nur auf ärztliches Anraten hin befristet gegeben
werden.
Dagegen sind die ganz natürlichen Schlafzeremonien und die aufgezeigten
kurzen "Schlaf-Vorgespräche" für die psychische Entwicklung des
'(behinderten) Kindes sehr wichtig. Das Kind braucht eine Phase
der Ruhe, in der die Vielfalt der Eindrücke abklingen kann. Es
wird ihm bei den täglich wiederkehrenden Riten ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt.
Dr. Erich Tischer, Rigaer Str. 8, 06128 Halle (Saale)
Das Literaturverzeichnis kann beim Autor angefordert werden.
Adressen von Fachkliniken zur Behandlung von Schlafstörungen
mit näheren Angaben enthält das Buch "Reha-und Fachkliniken in
Deutschland" vom Reha-Verlag GmbH, Postfach 201161, 53141 Bonn
Quelle: Deutsche Behinderten-Zeitschrift 6/97
|
|
 |

|
|